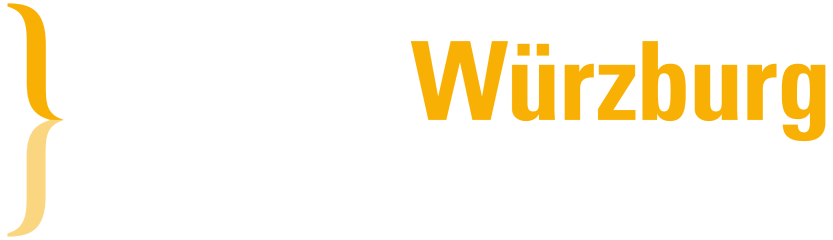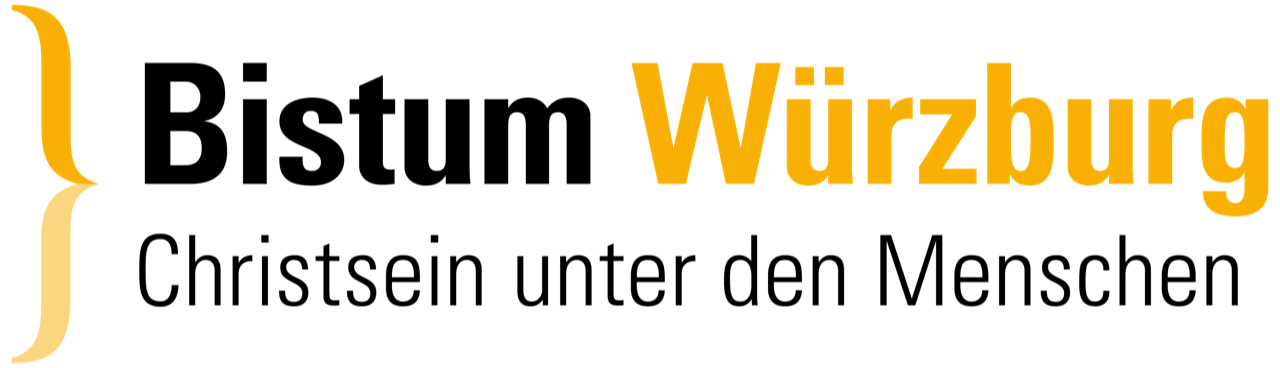Über Oberelsbach erhebt sich weithin sichtbar die elegante Turmfassade der „Rhön-Basilika” mit den Skulpturen der Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan und einer doppelten Kuppelhaube mit Laterne.
Kirchen- und Baugeschichte
An der Stelle einer Burgkapelle errichtet, wird die Filialkirche der Pfarrei Mellrichstadt um 1250 (1261 „rector ecclesia in Elspe”) zur Pfarrei erhoben. Die Pfarrer werden von Mellrichstadt, ab 1583 von Würzburg aus besetzt. Während des 17./18. Jh. geht dieses Präsentationsrecht an die Pröpste von Wechterswinkel, mit der Säkularisation an Bayern über. Unter Fürstbischof Julius Echter wird 1601 ein neu errichteter Vorgängerbau mit renoviertem Turm fertig gestellt. 1637 während des 30jährigen Krieges geplündert, wird er 1641 als ruinös bezeichnet. Doch erst nach 1751 wird ein neuer Kirchturm errichtet. 1760 zerstört jedoch ein Blitzschlag die Kirche soweit, dass sie abgebrochen werden muss.
Der Kirchenbau
Der heutige Kirchenbau wird 1765 - 84 durch Johann Michael Schmidt und Georg Schmidt aus Königshofen errichtet (Weihe durch Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal). Der vierachsige Saalbau mit Spiegeldecke mündet in einen zweijochigen eingezogenen Chor mit geradem Schluss, Tonne und Stichkappen. Renovierungen erfolgten 1893-95, 1925-27, 1953-56 und zuletzt 1992-2002 (Turm 2004).
Deckenmalereien und Stuck
Vermutlich schuf Johann Peter Herrlein die ursprünglichen Deckenmalereien. Diese wurden 1896 von Eulogius Böhler aus Würzburg übermalt und teilweise neu gestaltet. Gezeigt wird die Verklärung des HI. Kilian als vielfigurige himmlische Szene mit Trinität, Maria und Joseph, Johannes d.T., den drei HI. Königen, Aposteln Petrus und Paulus sowie weiteren Heiligen. Die Eckkartuschen geben die vier Evangelisten wieder, ergänzt durch die Heilige Familie vor dem Triumphbogen. Die beiden seitlichen Medaillons zeigen die Erzengel Raffael als Schutzengel und Michael mit Schild. Zwei aufgeschlagene Bücher im Hauptbild nennen wichtige Vertreter der Renovierungen 1896 bzw. 1950. Eine reiche, sehr qualitätvolle Stuckierung aus stilisiertem Muschelwerk fasst die Deckenbilder ein und bereichert den Triumphbogen.
Die Altäre
Den sechssäuligen Hochaltar mit alabasterweiß gefassten Heiligenfiguren, der Bischöfe Martin, Ambrosius, Augustinus und Nikolaus von Bari, dazu Engel und die Dreifaltigkeit im Auszug, fertigte 1774-76 der Neustädter Bildhauer Caspar Hippeli. Die Schreinerarbeiten schuf der Oberelsbacher Schreiner Hans Valentin Katzenberger mit seinen Söhnen. Das Altarblatt mit dem Martyrium des HI. Kilian und seiner Gefährten Kolonat und Totnan malte Johann Peter Herrlein aus Kleinbardorf 1786 (signiert; 1896 übermalt, nach 1997 freigelegt). Der Altar wurde 1784 gemeinsam mit den Seitenaltären durch den Würzburger Vergolder J. Eisenlauer gefasst. Ebenso gestaltete Caspar Hippeli in Zusammenarbeit mit dem Schreiner Katzenberger 1775 auch die Seitenaltäre (1796/97 gefasst).
Der Muttergottesaltar stellt Maria Immakulata zwischen den Heiligen Joachim und Anna dar, sein Pendant den HI. Sebastian zwischen den Ritterheiligen Georg und Florian, Putten bereichern die Aufsätze.
Der neue Volksaltar sowie der Ambo wurden 2000 durch Bischof Paul-Werner Scheele geweiht.
Die übrige Ausstattung
Ältestes Ausstattungsstück ist der 1672 gefertigte Taufstein mit achteckigem Becken und gedrehtem Säulenschaft. Die klassizistische Kanzel mit durch Urnenvasen bereichertem bauchigen Kanzelkorb und Christus Salvator mit Kreuz auf dem Schalldeckel entstand 1780. Neben den Seitenaltären finden sich der HI. Joseph mit Kind und die 1784 farbig gefasste Skulptur des HI. Kilian mit Buch (wohl von Caspar Hippeli), gegenüber der Kanzel Maria Königin mit Kind im Strahlenkranz. Die Stationsbilder wurden 1891 in Würzburg angekauft und 1892 geweiht. Der um 1770 geschaffene Orgelprospekt auf der oberen Südempore wurde 1997 erweitert. Die Orgelbaufirma Hoffmann aus Ostheim/Rhön fertigte ein neues Orgelwerk mit 28 Registern, das einen Vorgänger von 1895/96 ersetzt.
Die Geschichte der Glocken ist reich bewegt. Drei der im 19. Jh. neu gekauften Glocken wurden 1907 umgegossen (Fa. Klaus, Heidingsfeld). Zwei 1917 abgelieferte Glocken ersetzte man endlich 1925. 1942 wurden sogar drei Glocken abgeholt. Da die belassene Glocke klanglich unbefriedigend war, wurden 1950 vier neue Bronzeglocken durch die Fa. Czudnochowsky in Heidingsfeld gegossen.
Text: Dr. Karen Schaelow-Weber
Der Text wurde dieser Broschüre entnommen. Weitere Urheberrechtsangaben sind dort zu finden.
Eine weitere Kirchenbeschreibung folgt hier:
St. Kilian Oberelsbach
Eine Burg mit einer kleinen Kapelle dürfte wohl vor langer Zeit zuerst an der Stelle der heutigen St. Kilian Kirche in Oberelsbach gestanden haben. Von einem Vorgängerbau der heutigen Kirche wissen wir jedoch erst aus der Zeit des Fürstbischofs Julius Echter, der um 1601 eine Kirche an dieser Stelle neu errichten ließ. Diese Kirche wurde jedoch durch einen Blitzschlag im Jahre 1760 beinahe vollständig zerstört. Fünf Jahre später begann unter den beiden Baumeistern Johann Michael und Georg Schmitt von Königshofen der Neubau, der allerdings erst knapp zwei Jahrzehnte später, im Jahre 1784, vollendet werden konnte. Das Ergebnis dieser langen Bauzeit kann sich jedoch bis heute und auch von weitem aus sehen lassen. Die Geschlossenheit des Innenraums und die künstlerische wie handwerkliche Qualität der Ausstattung stellen eine Kostbarkeit des Kirchenbaus in der Region dar.
Der Kirchentypus ist als Saalbau mit im Langhaus flach eingezogener Spiegeldecke, mit vier Fensterachsen und eingezogenem Chor mit zwei Jochen, Tonne mit Stichkappen ausgeführt. Die Fenster sind stichbögig geschlossen. An der Westwand steht eine doppelstöckige Empore (um 1770). Die Westwand wiest eine sehr harmonische Gliederung auf, mit einem leicht hervorspringenden Turm als Risalit.
Im Innern wurde der von Bildhauer Christian Lux aus Bad Neustadt an der Saale gefertigte Hochaltar (um 1750) aus der Vorgängerkirche übernommen. Die Seitenaltäre aus dem Jahr 1775 stammen aus der Werkstatt von Hans Valentin Katzenberger aus Oberelsbach, bildhauerischen Arbeiten von Kaspar Hippeli aus Nordheim. Die Stukkaturen an der Decke der St. Kilian Kirche sind aus der Erbauungszeit, im Langhaus als Spiegeldecke mit eingerahmten Mittelbild und eingerahmten Kartuschen und stilisiertem Muschelwerk gearbeitet.
Die 1784 von dem bedeutenden Grabfeldmaler Johann Peter Herrlein gemalten Bilder sind um die Wende von 19. zum 20. Jahrhundert übermalt worden.
Der Hochaltar von 1750 nimmt die gesamte Breite des Chorraumes ein. Dieser wurde vom Bildhauer Christian Lux (um 1750) aus Bad Neustadt an der Saale verfertigt und vom dasigen Maler Cyprian Andreas Clement gefaßt. Es ist ein in die Breite gehender, die ganze Chorwand einnehmender Aufbau mit sechs Säulen, zwischen den Säulen die Figuren der Bischöfe Johann Chrysostumus, Ambrosius, Augustinus und Nikolaus.
Er enthält ein bei einer Restaurierung erst vor einigen Jahren wieder freigelegtes Bild des Martyriums des hl. Kilian uns seiner beiden Gefährten Kolonat und Totnan ebenfalls von Johann Peter Herrlein (signiert: 1786). Das Altarbild wurde von Udo Cox aus Gerolzhofen bei der (Innenrenovierung der Kirche 1997 - 2001) restauriert.
Die Seitenaltäre sind Rokokoarbeiten um 1775, über Eck gestellt, mit volutenbelgten Pilastern und Figuren, unter anderem des hl. Joachim und der hl Anna sowie der beiden Heiligen Georg und Florian. Anstelle von Bildern sind Figuren der Immakulata und des hl. Sebastian aufgestellt.
Lebhaft gestaltete Putten schmücken die Aufsätze.
Die Kanzel aus dem Jahre 1780 hat bereits klassizistische Ansätze, besitzt einen bauchigen Korpus sowie Urnen, einen Schalldeckel, Voluten und ein Salvatorfigur. Der Taufstein stammt aus dem Jahre 1672 und dürfte mit seinem achteckigen Becken das älteste Austattungstück der Kirche sein.